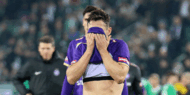Machtpolitische Spiele in SPÖ: "So geht das nicht mehr"
Innerhalb der SPÖ regt sich erste Kritik an der bei einer Präsidiumsklausur am Sonntag beschlossenen Absage der Organisationsreform. Ursprünglich sollten die Pläne zur Öffnung der Partei und Stärkung der Mitgliedermitbestimmung beim Parteitag Ende November abgesegnet werden, nun soll die Reform auf Druck der Wiener SPÖ überarbeitet und erst am nächsten Parteitag in zwei Jahren umgesetzt werden.
Erste Kritik an diesem Vorgehen, das am Sonntag still und heimlich über die Bühne ging und bei einer anschließenden Presseerklärung von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda auch nicht zur Sprache kam, gibt es aus der Wiener SPÖ-"Sektion 8". "Nichts wurde in der SPÖ so lange und breit diskutiert, wie Organisationsreformen. Es gibt keinen inhaltlichen oder organisatorischen Grund, diesen Minimalkompromiss zu kübeln. Es gibt nur einen machtpolitischen und, mit Verlaub, den haben wir satt", erklärte die notorisch kritische SPÖ-Sektion via Twitter.
Kompromiss
Die Reform sei demnach ein Kompromiss gewesen, den der bisherige Bundesgeschäftsführer Max Lercher nach viel Einsatz allen Beteiligten abgerungen habe. Der Vorschlag habe durchaus Luft nach oben, allerdings sei die Forderung nach einer Urabstimmung von Koalitionsverträgen bahnbrechend. "Quasi eine Versicherung gegen den Gusenbauer-Effekt 2007." Dem früheren SPÖ-Chef und Bundeskanzler Alfred Gusenbauer war damals vorgeworfen worden, bei den Koalitionsverhandlungen von der ÖVP über den Tisch gezogen worden zu sein.
Amtszeit-Klausel
Die "Amtszeit-Klausel", gegen die sich vor allem der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig wehrt, wird laut "Sektion 8" nur "symbolischen Effekt" haben. 66 Prozent seien ja keine echte Hürde, wenn es, wie in der SPÖ üblich, nur einen Kandidaten für eine Position gibt. "Es geht also um etwas prinzipielles. Nichts soll sich ändern. Niemand soll sich ändern müssen. Niemand will Macht abgeben, am wenigsten an die Mitglieder", so die kritischen Genossen.
Die SPÖ operiere 2018 mit einer 130 Jahre alten Struktur. "Personaldiskussionen fallen hinter verschlossenen Türen, völlig unnachvollziehbar und mitunter ohne irgendeine erkennbare Strategie. Die, die hinter geschlossenen Türen entscheiden, verlangen aber blinde Loyalität von allen anderen. Vor allem von den Mitgliedern, die Beiträge zahlen, Hausbesuche machen und Überzeugungsarbeit leisten. So geht das nicht mehr. Wir fordern, die SPÖ vom Kopf auf die Füße zu stellen. KandidatInnenlisten, Parteivorsitzende und Vorstandsmitglieder müssen sich einem Votum der Mitglieder stellen. Wir fordern ein Ende der Einheitslisten. Wir fordern noch vieles mehr." Kritisch wird von der "Sektion 8" auch angemerkt, dass das Abstimmungsergebnis der Mitgliederbefragung "als bedeutungslos" beiseite geschoben werde.
Kritik gab es aber auch aus anderen Teilen der SPÖ-Basis. "Zählen tausende Parteimitglieder gar nix mehr", fragte etwa der Vorsitzende einer oberösterreichischen SPÖ-Sektion nach Bekanntwerden der Reformvertagung via Twitter die Parteispitze. Von den SPÖ-Mitgliedern gab es für die Vorhaben im Rahmen einer Mitgliederbefragung vor dem Sommer bereits grünes Licht. Über 70 Prozent der rund 38.000 Teilnehmer stimmten für die im Fragebogen abgetesteten Organisationsthemen. Auch die Parteigremien segneten die Pläne ab.
Die Organisationsreform beinhaltete Zwei-Drittel-Schwelle für öffentliche Ämter, wenn das entsprechende Mandat bereits zehn Jahre ausgeübt wurde. Der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig sprach sich mehrfach gegen eine solche Zehnjahresfrist aus. Im letzten Entwurf war die Zwei-Drittel-Schwelle deshalb nur für Nationalrats- und EU-Abgeordnete der SPÖ vorgesehen, Bundesräte und die Landesebene waren ohnehin bereits ausgenommen. Weitere Punkte betrafen eine Mitglieder-Abstimmung über Koalitionsabkommen, niedrigere Quoren für die Initiierung von Mitgliederbefragungen sowie die Einschränkung der Anhäufung von Ämtern - Mehrfachbezüge durch Mandate sollten durch höhere Solidaritätsabgaben zurückgedrängt werden.