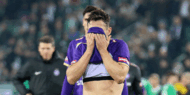Wenn Religionswechsel aus "innerer Überzeugung" erfolgt, lasse dies nicht pauschal auf Missbrauchsabsicht schließen
Wechselt ein Asylanwärter nach Verlassen seines Landes die Religion und beruft sich dann in seinem Asylantrag auf die damit einhergehende Verfolgung in seiner Heimat, darf sein Antrag nicht pauschal als "missbräuchlich" abgelehnt werden. So urteilte am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Der Gerichtsspruch geht auf den Fall eines Iraners zurück, der in Österreich einen Folgeantrag auf internationalen Schutz gestellt hatte.
Ein erster Antrag des Mannes war von den österreichischen Behörden abgelehnt worden. Im zweiten Anlauf ("Folgeantrag") führte der Mann an, dass er in der Zwischenzeit zum Christentum konvertiert sei und befürchte, deshalb im Iran verfolgt zu werden. Die Behörden gewährten im daraufhin "subsidiären Schutz" und eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, heißt es in der Aussendung des EuGH. Er habe glaubhaft gemacht, aus "innerer Überzeugung" zum Christentum konvertiert zu sein und die Religion "aktiv zu leben". Daher sei er im Iran der Gefahr einer Verfolgung ausgesetzt.
Nicht als Flüchtling anerkannt
Als Flüchtling wurde er aber nicht anerkannt, da der Verfolgungsgrund (sein christlicher Glaube) noch nicht existiert habe, als der Mann noch im Iran lebte. Hier widerspricht der EuGH: Das EU-Recht lasse nicht den pauschalen Schluss zu, "dass jeder Folgeantrag, der auf Umständen beruht, die der Antragsteller nach Verlassen des Herkunftslandes selbst geschaffen hat, auf eine Missbrauchsabsicht und die Absicht zurückzuführen ist, das Verfahren für die Zuerkennung internationalen Schutzes zu instrumentalisieren", so die europäischen Richter.
Jeder Fall sei individuell zu beurteilen. Wenn die Person glaubhaft macht, aus "innerer Überzeugung" die Religion gewechselt zu haben (was die österreichischen Behörden auch so sahen) und die "Voraussetzungen für eine Qualifizierung als Flüchtling" erfüllt seien, sei auch die "Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen".
Der EuGH urteilt allerdings nie in einem konkreten Fall, sondern beantwortet nur Auslegungsfragen zum EU-Recht. Im vorliegenden Fall muss nun wieder der österreichische Verwaltungsgerichtshof entscheiden.