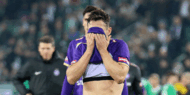Knappe Entscheidung in Dublin gegen EU-Kommissar Barnier.
Europas Konservative und Christdemokraten haben ihrem frisch gewählten Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker nicht gerade einen leichten Start verpasst. Weniger als die Hälfte der 828 Delegierten beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) in Dublin gaben dem Luxemburger ihre Stimme, auch wenn er sich mit 382 zu 245 Delegiertenstimmen gegen den Franzosen Michel Barnier durchsetzen konnte.
In den Hallen des Dubliner Kongresszentrums kam nach der Verkündung des Ergebnisses nur wenig Stimmung auf - Versicherungen Junckers zum Trotz, er habe nun das Vertrauen der Anwesenden errungen. Es gibt wohl Grund zur Skepsis.
Der Parteikongress fand an einem kritischen Zeitpunkt für die EVP statt. Seit 1979 dominiert die Fraktion der Konservativen und Christdemokraten das Europaparlament. In der Eurokrise stellt sie auch eine Mehrheit der Staats- und Regierungschefs - auch wenn ihr die Abspaltung der britischen Konservativen und kleinerer Parteien aus Osteuropa 2009 einen Dämpfer versetzte.
Nach Dublin stellt sich jedoch die Richtungsfrage. Die EVP verbucht die Rettung der Eurozone und die Sparmaßnehmen als ihren Erfolg, doch die öffentliche Unterstützung für eine Fortsetzung des Kurses ist fraglich. Nicht zuletzt deshalb beteuerte Schulz in Dublin seine soziale Ader: "Wir sind nicht die Partei der blinden Sparmaßnahmen, Privatisierung und Deregulierung", war etwa von ihm zu hören. Merkel machte hingegen die Leitlinien der EVP nach der Eurokrise deutlich: Weitere Budgetsanierung und Bürokratieabbau. "Arbeitsplätze werden nicht vom Staat geschaffen", gab die Kanzlerin ihre Parteikollegen aus Europa mit auf den Weg.
Sorge macht Juncker vor allem die Konkurrenz. Nach letzten Prognosen könnten die Europäischen Sozialdemokraten unter dem Deutschen Martin Schulz erstmals mehr Mandate im EU-Parlament erreichen und damit auch Anspruch auf den Kommissionspräsidenten erheben.
Hoffnungen machen sich die Linken, weil die Debatte um die Schuldenkrise der Sorge über hohe Arbeitslosenzahlen gewichen ist. "Wir dürfen nicht einfach die simplifizierende Idee akzeptieren, dass die Sozialisten besser für diesen Kampf positioniert sind", beschwor Juncker die Delegierten. Man dürfe die Sozialpolitik nicht in ihren Händen lassen. Seine Worte dürften aber besonders in den Krisenstaaten wenig Anklang finden, wo konservative Parteien bemüht sind, weitere Sparmaßnahmen durchzusetzen.
Für Unfriede sorgte in Dublin auch die Frage des Mandats. Juncker ist nun zum Spitzenkandidaten gewählt, aber wofür? Der Luxemburger erhebt den Anspruch auf das Amt des Kommissionspräsidenten, doch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat klargemacht, dass sie dazu nicht automatisch bereit ist. Das scheint politisch leicht zu begründen: Im Fall eines Wahlsiegs des Mitte-Links-Lagers müsste sie Schulz für den deutschen Sitz in der Brüsseler EU-Kommission nominieren. Doch auch wenn die EVP stärkste Kraft wird, könnte Merkel zu anderen Kandidaten für den obersten EU-Posten schielen, wird spekuliert. So wird etwa der deutschen Kanzlerin nachgesagt, viel von Irlands Premier Enda Kenny zu halten.
Am Ende könnten die heuer erstmals bestimmten Spitzenkandidaten der europäischen Parteienfamilien nicht mehr sein als ein weiteres Puzzlestück in der komplizierten Personalpolitik der Europäischen Union. Juncker, so heißt es, werde vielleicht nicht Kommissionspräsident. Aber seine "Kandidatur" könne als Mandat gewertet werden, ihn nach der Wahl zum Ratspräsidenten zu machen, oder zum EU-Außenbeauftragten.
In jedem Fall bilden die Weichenstellungen vor der Europawahl eine Art Modellfall für das Gewicht des Parlaments in der EU. Erst der 2009 von den Staats- und Regierungschefs unterschriebene Lissabon-Vertrag räumte der Abgeordnetenkammer ihnen gegenüber Mitspracherecht ein und legte fest, dass die Stärke der Parlamentsfraktionen sich in der Kommission widerspiegeln müsse. Nun wird sich zeigen, was das in der Praxis bedeutet.