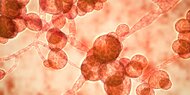IS könnte wieder an Boden gewinnen - Auch Auswirkungen auf politische Lage in Südosttürkei möglich.
Wien/Damaskus. Die türkische Militäroffensive in Nordsyrien, die sich in erster Linie gegen die syrischen Kurden richtet, hat den Konflikt um das in mehreren Staaten lebende kurdische Volk erneut in den Focus der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit gerückt.
Unter Führung der Miliz YPG (Volksverteidigungseinheiten) hatten sich die Kurden im Zuge des 2011 ausgebrochenen syrischen Bürgerkriegs im Norden des Landes eine starke Machtposition mit einer De-Facto-Autonomie aufgebaut. Ihre entscheidende Rolle im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) wurde im Westen, nicht zuletzt in den USA, äußerst geschätzt. Anfang 2015 vertrieben sie den IS aus Kobane an der türkischen Grenze.
Im Oktober 2015 wurde das kurdisch-arabische Bündnis Syrische Demokratische Kräfte (SDF) gegründet, das von den YPG dominiert wird und von den USA direkte militärische Unterstützung erhielt. Im Sommer 2017 vertrieben die SDF den IS aus seiner Hochburg Raqqa.
Der Entschluss von US-Präsident Donald Trump, US-Truppen aus dem Gebiet zurückzuziehen, hat selbst bei seinen Republikanern zu harscher Kritik geführt, weil er damit der Türkei grünes Licht für ihre seit längerem angekündigte umstrittene Militäraktion gegeben hat. Dies könnte letztlich zu einem neuerlichen Erstarken des IS führen.
Die türkische Führung betrachtet die YPG als Ableger der von Ankara als Terrororganisation eingestuften, vor allem in der Südosttürkei agierenden Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die Offensive zur Errichtung einer 30 Kilometer breiten "Sicherheitszone" in Syrien wird damit zweifellos auch Auswirkungen auf die Türkei haben. Neue Kämpfe und Anschläge könnten die Folge sein. Zudem ist damit zu rechnen, dass die in Europa lebenden Kurden massive Protestdemonstrationen veranstalten werden.
Ob die türkische Bevölkerung über die zu erwarteten zahlreichen "Sehitler" (Märtyrer) in den Reihen junger Soldaten begeistert ist, ist zu bezweifeln. Präsident Recep Tayyip Erdogans Rechnung, seiner angekratzten Popularität neuen Glanz zu verleihen, könnte sich als Schuss nach hinten erweisen. Bisher hat er aber jede Kritik aus dem Ausland zurückgewiesen. Trumps erratische Drohungen mit Wirtschaftssanktionen ließen ihn unbeeindruckt, ebenso die Warnungen der Europäer. Stattdessen drohte er mit einer Öffnung der Grenzen nach Westen, die eine Flüchtlingsflut nach Europa auslösen würde.
Die Kurden im Norden Syriens, die laut der Nachrichtenagentur AFP als ethnische Minderheit schätzungsweise 15 Prozent der Bevölkerung darstellen, wurden über Jahrzehnte diskriminiert. Die meisten Kurden sind sunnitische Muslime, doch gibt es auch Christen und Yeziden unter ihnen. Unter dem früheren Präsidenten Hafez al-Assad, der das Land bis zum Jahr 2000 beherrschte, waren Hunderttausende Kurden staatenlos.
Daran änderte sich erst etwas, als Assads Sohn Bashar, der danach an der Spitze des Staates kam, durch den Bürgerkrieg in die Enge getrieben wurde. Rund 300.000 Kurden wurde dann die syrische Staatsangehörigkeit zuerkannt. Eine Autonomie will das Assad-Regime den Kurden aber bis heute nicht gewähren.
Im Bürgerkrieg nahmen die Kurden eine weitgehend neutrale Position ein. Sie hinderten die Aufständischen daran, in die vorwiegend von Kurden bewohnten Gegenden vorzudringen. Die vom Bürgerkrieg geschwächten Regierungseinheiten gaben zahlreiche Positionen im Norden und Osten des Landes auf. Damit erhielten die Kurden Spielraum zur Vorbereitung einer Autonomie in den von ihnen kontrollierten Gebieten ("Rojava" - "West-Kurdistan"), in denen es reichhaltige Rohöl-Vorkommen gibt.
Die wichtigste Partei der Kurden, die Partei der Demokratischen Union (PYD), proklamierte 2013 für die von den Kurden kontrollierten Gebiete eine Halb-Autonomie. Die Bemühungen um eine Konsolidierung der Macht wurden danach fortgesetzt, die Kurden arbeiteten konsequent am Aufbau eigener Sicherheitskräfte, eigener Schulen und einer eigenen Verwaltung. Politische Ämter werden je mit einem Mann und einer Frau besetzt. 2016 beanspruchten sie für sich eine "föderale Region" aus mehreren Bezirken und verabschiedeten einen "Sozialvertrag" - eine Art Verfassung. 2017 wählten sie eigene Kommunalvertretungen.
Die Türkei war alarmiert über die Autonomiebestrebungen der Kurden an ihrer Südgrenze. Ankara startete 2016 und 2018 mit verbündeten syrischen, meist islamistischen Rebellen eine Offensive gegen die YPG im nordsyrischen Afrin. Russland ließ die Türkei gewähren, nachdem die PYD es abgelehnt hatte, eine Rückkehr der Assad-Truppen nach Afrin zu erlauben. Damaskus verurteilte zwar die "Aggression" der Türkei, intervenierte aber nicht.
Wie sich die jetzige türkische Offensive auf den Kurdenkonflikt in er Region auswirken wird, ist nicht abzusehen. Die kurdischen "Peshmerga" ("die den Tod vor Augen haben") gelten als zähe Kämpfer. Beim Kampf um Kobane, der von Journalisten aus aller Welt von der türkischen Grenze aus beobachtet werden konnte, erhielten die YPG auch Unterstützung von PKK-Kämpfern und irakischen Kurden.
Dass die schätzungsweise 30 Millionen Kurden, die im wesentlichen in der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran leben, jemals einen eigenen Staat haben werden, ist nicht zu erwarten. Die Kurden streben heute vielmehr eine Autonomie innerhalb jener Staaten an, in denen sie beheimatet sind.
Zwar hatte der nach dem Ersten Weltkrieg 1920 unterzeichnete Vertrag von Sèvres Spielraum für die Gründung eines unabhängigen Kurdistans gelassen. Dies wurde jedoch im Vertrag von Lausanne 1923 gestrichen. Zwar hatten nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches die Kurden im türkischen Unabhängigkeitskrieg an der Seite des späteren Staatsgründers gekämpft. Kaum hatte Mustafa Kemal Atatürk aber 1923 seinen Nationalstaat errichtet, wurden die Kurden kurzerhand in "Bergtürken" umbenannt.