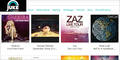Musik zum Mieten macht iTunes, Amazon und Google Konkurrenz.
Was Apple mit iTunes schon seit zehn Jahren vormacht, hat inzwischen auch der Internet-Riese Google als Geschäftsmodell für sich entdeckt und bietet ebenfalls Musik zum Kauf im Internet an - seit gestern auch in Österreich ( wir berichteten ). Allerdings geht es Google dabei wie dem Hasen im Wettlauf mit dem Igel, denn die Konkurrenz ist schon da - und im Übrigen spielt die Musik schon längst woanders. Musik-Streaming-Anbieter wie Spotify , Juke , Deezer oder Simfy haben erkannt, wohin die Reise wirklich geht: Der verwöhnte Musik-Fan will nicht einzelne Lieder "kaufen", die ihm letztlich doch nicht gehören, sondern er will alles haben, und das immer und überall.
152 Jahre lang ununterbrochen Musik
Was bekommt man, wenn man einen MP3-Player und ein Smartphone mit Breitband-Internet kreuzt? Eine Musiksammlung, die 20 Millionen Titel umfasst, versprechen Spotify & Co. Das ist so viel, dass mehrere Menschenleben zum Anhören nicht ausreichen würden - 152 Jahre lang könnte man nach grober Berechnung ununterbrochen Musik spielen, ohne ein Lied zweimal zu hören. Oder, um es mit der eigenen Musiksammlung zu Hause vergleichen zu können: Audio-CDs würden aufeinander gestapelt einen 10 Kilometer hohen Turm ergeben, die gleiche Sammlung im Mp3-Format würde 80 handelsübliche 1-Terabyte-Festplatten füllen.
Flatrate
Das Geschäftsmodell ist eine Musik-Flatrate: Man bezahlt eine monatliche Abo-Gebühr und bekommt im Gegenzug für die Dauer des Abo-Vertrages Zugriff auf die gesamte Musiksammlung des Anbieters. Der Abo-Preis beträgt bei allen Anbietern knapp 10 Euro, das dürfte offenbar die Schmerzgrenze der Kunden sein. Wer sich durch Werbung nicht gestört fühlt, der kann es sogar noch billiger oder sogar umsonst kriegen.
Die Diskussion, ob man nicht besser CDs kaufen sollte statt für Musik aus dem Internet zu bezahlen, ist beinahe ein Glaubensstreit. Dabei muss einem aber klar sein, dass der Unterschied nicht darin besteht, ob einem die Musik "gehört" oder nicht. Egal, ob man Musik "streamt" oder eine CD kauft, man erwirbt dabei niemals das geistige Eigentum an dem Werk, sondern immer nur ein Nutzungsrecht - ähnliche wie bei Computerprogrammen.
Mobiles Breitband-Internet brachte den Durchbruch
Möglich wurde das Musik-Streaming auch für unterwegs erst durch die hohe Verfügbarkeit von mobilem Breitband-Internet. Die Vorteile sind vielfältig: Die Musik kann auf verschiedensten Geräten - Handy, PC, HiFi-Anlage - abgespielt werden, ohne dass man die Sammlung erst zwischen den verschiedenen Geräten synchronisieren muss. Das Anhören setzt auch keine permanente Internet-Verbindung voraus, weil man die einzelnen Stücke auch auf dem Endgerät speichern kann, wo sie so lange abgespielt werden können, wie das Musik-Abo besteht - kündigen kann man üblicherweise einen Monat im Voraus.
Nachteile
Aber die Sache muss doch einen Haken haben, sagt man sich. Den hat sie auch, und nicht nur einen: Wenn man davon ausgeht, dass eine Minute Musik komprimiert ca. 1 MB Datenvolumen entspricht, ist ein monatliches Datenvolumen von 1.000 MB, wie es in einem heutzutage typischen Handyvertrag inkludiert ist, spätestens nach 17 Stunden Musikhören verbraucht.
Der zweite große Haken ist juristischer Natur und betrifft die komplizierten Vertragswerke zwischen den Streaming-Diensten einerseits und den Plattenverlagen bzw. Verwertungsgesellschaften andererseits. So würde z.B. ein Beatles-Fan und Spotify-Neukunde bald enttäuscht feststellen, dass Spotify nicht die Rechte für die Beatles besitzt und sie daher auch nicht im Angebot hat.
Ein wesentlicher Kritikpunkt an den Streaming-Diensten ist der Vorwurf, dass die Musiker selbst dabei ausgebeutet würden - sie sollen pro Lied (Stream) oft nur den Bruchteil eines Cents bekommen. Exakte Zahlen darüber gibt es nicht, die Rechte-Verträge sind nicht einheitlich. Letztlich entscheiden aber die Plattenlabels darüber, wie viel ein Künstler bekommt und ob sein Werk auf Spotify, Deezer, Juke oder Simfy verfügbar ist. (Ivan Novak/APA)