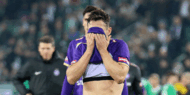Vor 21 Jahren zerstörten Terror-Flugzeuge die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Centers. ÖSTERREICH-Korrespondent Herbert Bauernebel erlebte den Horror vor Ort hautnah mit.
Inferno aus dem Nichts. Dieses Geräusch. Was ist das? Ein Flugzeug? Muss es sein, die Düsentriebwerke sind deutlich zu hören. Aber wo? Und wieso so laut? Noch saß ich gelassen an meinem Schreibtisch, den Kaffee neben dem Laptop. Jetzt sitze ich wie festgefroren im da. Dieses Geräusch! Ich kann es nicht einordnen. Über New York kreisen ständig Jumbos. Doch dieses Heulen der Jumbo-Treibwerke? So nahe, so niedrig.
Plötzlich geht alles blitzschnell. Die Triebwerke heulen noch mal richtig los. Voller Schub. Ich starre durch das Fenster, auf die Fassade des 417 Meter hohen WTC-Nordturms, fünf Blöcke vor mir. Dem Turbinengeheul folgt das Unvorstellbare: zuerst ein dumpfer Schlag, dann eine gewaltige Explosion – laut, durchdringend, Nerven zerfetzend. Die Fenster vibrieren. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Adrenalin schießt durch den Körper. Ich springe aus dem Sessel. Flug American Airlines 11 hat sich mit 750 Stundenkilometer in die Fassade gebohrt.
Wie in Zeitlupe. Alles läuft wie in Zeitlupe ab: Ich sehe, wie Stichflammen aus mehren Stockwerken schießen. Die umliegenden Hochhäuser schleudern den ohrenbetäubenden Knall als Echo zurück: „Boom, boom, boom, boom...“
Papierfetzen segeln. „Was war das?“, fragt meine Frau Estee. Sie ist acht Wochen schwanger. Unser erstes Kind. Wir starren kurz wortlos auf die unglaubliche Szene dreihundert Meter über uns. Der schwarze Rauch ist durchsetzt von Akten, sie segeln jetzt in der leichten Brise durch den Hochhauswald.
Nur 17 Minuten lang währt das Wunschdenken, dass es sich um einen Unfall handelt. Wieder nähert sich rasant das Dröhnen von Flugzeugantrieben, diesmal von Süden. Die Triebwerke heulen auf, der dumpfe Schlag des Aufpralls, der metallische Knall der Explosion. Getroffen wurde der WTC-Südturm von Flug United Airlines 175. Klar ist: Wir werden angegriffen. Mit Verkehrsmaschinen.
„Ich muss los!“ Estee und ich starren schweigend nach draußen. Mein Herz pocht: Durch den Kopf spukt ein wilder Mix an Emotionen: Angst, Unglauben, Schock. Aber auch journalistische Instinkte. Ich muss los, laufe zum Platz zwischen den lodernden Türmen. Fassadenteile liegen herum, blanke Metallelemente, möglicherweise von den Jumbos.
Sie springen! Wer springt? „Oh my God, no!“, ruft plötzlich eine Afroamerikanerin hinter mir. Sie starrt nach oben. Ihre Augen sind vor Entsetzen weit aufgerissen. Sie brüllt: „They are jumping!“ Sie springen? Wer springt? Als ich begreife, graut mir schon vor dem Umdrehen. Dann sehe ich einen fallenden Körper, die Hände zucken, der Körpers dreht sich um die eigene Achse. Ist es ein Mann oder eine Frau? Ist das wichtig? Hier stürzt ein Mensch zu Tode.
Stockfinster, totenstill. Ich habe gerade mit Estee telefoniert, als neben mir Menschen plötzlich panisch losrennen, einige so hastig, dass sie gleich bei den ersten Schritten hinfallen. Unendlich langsam dämmert mir: Einer der Türme ist eingestürzt. Schon sehe ich die Staubwolke. Ich hechte unter einen Lieferwagen, liege am Bauch. Mein ganzer Körper ist angespannt, verkrampft. Binnen Sekunden rast die Staubwolke über mich hinweg. Es wird dunkel, sehr schnell. Und total. Es ist stockfinster – und totenstill. Als wäre der Film gerissen.
Todesangst. Und der Staub! Dick, mit metallischem Geschmack legt er sich über mich, nimmt mir die Luft. Ich atme das zu weißem Pulver zermalmte World Trade Center. Todesangst kriecht in meinem Körper: Muss ich hier ersticken? Die Atemzüge werden schwerer, der Giftstaub füllt meine Lungen. Ich schwanke zwischen Zorn und Trauer: Ich denke an meine Vorfreude, endlich Vater zu werden, ein Kind großzuziehen. Unser Kind! Und voller Grauen denke ich dran. dass Estee es nun vielleicht alleine großziehen muss.
Wie ein Geist. Ein Ruck geht durch meinen Körper, ein Aufbäumen. Ich krieche unter dem Wagen hervor., stolpere durch die Türe zu einem Chinarestaurant. „Jesus Christ“, ruft jemand. „Um Gottes willen!“ Ich sehe aus wie ein Geist, bin komplett mit weißem Staub bedeckt. Gierig sauge ich die staubfreie Luft ein. Doch gleich lähmt mich der nächste panische Gedanke: Estee! Ich muss zu ihr – bevor sie verrückt wird vor Sorge.
Ich habe den Kollaps des WTC-Südturmes überlebt, jetzt renne ich zu meiner Frau Estee.
Sie schreckte das ohrenbetäubende Geknatter der aufeinander stürzenden Etagen auf. Fast mechanisch drückt sie die Telefon-Wiederwahltaste. Kein Durchkommen. Die erzwungene Untätigkeit treibt sie zum Wahnsinn: Sie will mich suchen gehen, doch im letzten Moment erreicht sie eine Freundin, die ihr den gefährlichen Plan ausredet: „Bitte, um Himmels willen, bleib in der Wohnung“. Im Chaos würden wir auf den Straßen bloß aneinander vorbeilaufen. Dazu steht auch der Nordturm kurz vor dem Kollaps.
Sie lässt sich umstimmen. Ich renne da schon durch die Lobby, zwänge mich in den Lift. Alle starren mich fassungslos an. Fast habe ich vergessen, wie ich aussehe, weiß von Kopf bis Fuß, die Haare groteske Staubskulpturen, das Gesicht verkrustet, durchsetzt von den Schweiß-Schlieren.
Im 27. Stock läutet mein Handy! Sie ist es. „Ich bin okay“, stammle ich. Vor Erleichterung breche ich in Tränen aus. „Ich bin schon im Lift“, sage ich stockend. Im Lift weinen nun einige mit. Rührung über zumindest ein kleines Happy End an diesem Albtraumtag. Sie wartet bereits an der geöffneten Tür. Wir umarmen uns so fest, dass es fast weh tut. Der weiße Staub klebt nun auch an ihr. Egal, wir sind wieder zusammen!
Kurze Zeit später stürzt der Nordturm ein. Draußen weht der Rauch über den nun 20 Zentimeter hoch mit Staub und Asche bedeckten Balkon.
Doch was ist nun eigentlich zu tun? Bürgermeister Rudy Giuliani ist im TV zu hören: Er fordert die Einwohner auf, Lower Manhattan „ruhig und geordnet“ auf dem Fußweg zu verlassen. „Let´s go“, sage ich fast reflexartig zu Estee. Sie nickt, holt eine Schere, zerschneidet ein altes T-Shirt, dessen Teile wir uns behelfsmäßig um den Mund binden. Dann machen wir uns auf den Weg zu Freunden nach Brooklyn.
Der Menschenstrom schiebt sich zur Auffahrt der Brooklyn Bridge. Es ist ein stummer Abmarsch, kaum wer redet, die meisten blicken beim Gang über die Brücke stoisch nach vorne, den Kopf gesenkt. Die Stadt, die niemals schläft und alles kann, ist geschlagen. Für einen Moment zumindest. Nur ab und zu dreht sich jemand um. Niemand will den unfassbaren Anblick richtig wahrhaben: Die vielleicht ikonischsten Gebäude der Erde, die New Yorker „Twin Towers“, sind weg, verschwunden.
Meinen persönlichen Tiefpunkt erlebe ich jedoch erst am nächsten Tag, als langsam die menschliche Dimension der Tragödie durchsickert. Boote mit Leichen seien die ganze Nacht über zwischen der WTC-Ruine und New Jersey über den Hudson gependelt, heißt es im TV. Ich vergrabe mein Gesicht in meinen Händen, lasse jetzt alles raus. Mitgefühl, Trauer, auch Wut, Verzweiflung.
Doch schon Stunden später befreit sich New York aus seiner ersten Lähmung. Zuerst mit einer Welle an Hilfsbereitschaft: Bürger bringen alles, was sie haben, alte Schuhe für die Arbeiter auf Ground Zero, Lebensmittel, Getränke, Hosen, T-Shirts, Medikamente. Unter den Freiwilligen steht auch ein Chinese. Er hält ein Bastkörbchen mit „Dim Sum“.
Ich starre ihn an, wische mir eine Träne weg. Ich spüre den Ruck, der durch die Stadt geht: New York lässt sich nicht unterkriegen. Es wehrt sich, es trotzt, rückt zusammen. Plötzlich skandieren Hunderte an der West Street bei der Vorbeifahrt der Einsatzfahrzeuge: „USA! USA!“ Ich klatsche mit. Ich bin jetzt New Yorker.
Die Metropole schafft ihr Comeback, doch US-Präsident George W. Bush dirigierte die Supermacht in einen ruinösen, im Irak völlig fehlgeleiteten „Krieg gegen den Terror“.
Unser Sohn Maxwell wurde im April 2002 geboren, als noch Schutt aus der WTC-Grube geführt wurde. Unsere Tochter Mia 2007. Nie dachten wir daran, New York zu verlassen.
Als im Mai 2011 SEAL-Kommandos Al Qaidas Terrorchef Osama Bin Laden töteten, gibt es einen vorläufigen Abschluss: Mein Ausbruch roher Emotionen zeigte, dass ich doch auf diesen Moment gewatet habe. Wieder dachte ich an die Zäune mit den Vermisstenpostern. Und erstmals seit fast zehn Jahren ein Hoffnungsschimmer: Vielleicht müssen wir doch nicht bis ans Ende aller Zeiten in ständiger Terrorangst leben.
Herbert Bauernebel, New York