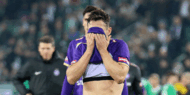Erste Group-Chef Andreas Treichl tritt für Gespräche auf EU-Ebene hinsichtlich der aktuell diskutierten Bankensteuer ein. Eine nur österreichspezifische Lösung wäre für das heimische Bankwesen und die Region ein starker Wettbewerbsnachteil. "Ich würde eine paneuropäische Diskussion sehr begrüßen", so Treichl.
Vom Bankengipfel, zu dem Kanzler Faymann für den 22.2. eingeladen hat, erwartet sich Treichl kein konkretes Ergebnis, aber Ansätze für einen "vernünftigen Weg". "Vielleicht gelingt es, einen Vorschlag zu machen, der in der EU auf breiterer Basis Gefallen findet, das wäre schon ein großer Erfolg", sagte Treichl.
Eine Besteuerung dürfte nicht wieder darin enden, den Banken Kapital wegzunehmen. Das wäre nur ein populistische Maßnahme. "Eine Steuer ist kein Beitrag zur Bewältigung einer Krise, sondern eine Umverteilung von Banken zum Staat." Eine Bankensteuer sollte daher nur eingeführt werden, wenn man damit auch einen richtigen regulatorischen Effekt erzielen könnte. Sie solle darauf abzielen, Spekulationsgeschäfte zu erschweren und damit die Finanzierung der Realwirtschaft zu unterstützen, so Treichl.
Ärger in der Bevölkerung "verständlich"
Auch er teile den Ärger der Bevölkerung darüber, dass viele Banken wie vor der Krise weiter machen würden, so der Erste-Boss. Banken hätten einmal ein sehr gutes Image gehabt, und hätten es geschafft, innerhalb kürzester Zeit dieses auf das Niveau der Politiker fast ganz nach unten zu bringen. Vor allem von regulatorischer Seite her werde zu wenig dafür getan, dass es zu einer Differenzierung zwischen realen und spekulativen Bankgeschäften kommt.
Bankgeschäfte seien viel zu stark in einen Topf geworfen worden. Man hätte von Anfang an erkennen müssen, dass das, was die Wirtschaft insgesamt aus der Krise herausführt, nur darauf basieren könne, dass man Banken die Kreditvergabe erleichtert und dass Kapital freigesetzt wird, indem man spekulative Geschäft wesentlich stärker durch Kapital hinterlegt.
Hier müsse es zu einer wesentlich stärkeren Diskussionsbereitschaft zwischen Politik, Regulatoren und Banken kommen. Regulatoren würden in Auftrag der Politik arbeiten. Es sei eine Situation entstanden, die nicht im Sinne der Auftraggeber ist. "Ich erwarte mir noch dramatische Entwicklungen in regulatorische Hinsicht", so Treichl.
Aber nicht nur die Banken, sondern die Finanzwirtschaft per se sollte reguliert werden, alle, die die Möglichkeit haben, Finanzprodukte zu verkaufen, sollten davon betroffen sein. Den Banken etwa sollte nicht wieder die Möglichkeit gegeben werden, mit Sicherheit Geschäfte zu machen, und es sollte ermöglicht werden, dass Banken in eine geordnete Insolvenz gehen können, indem ein wirtschaftliches Gleichgewicht geschaffen wird.
Einlagensicherung überdenken
Auch bezüglich der Einlagensicherung müsste man sich was überlegen. Wenn eine Einlage überall sicher sei, dann sei es egal, ob die Bank gut oder schlecht sei, ob sie risikoarme oder risikoreiche Geschäfte mache. Generell müsste man sich bei der Beaufsichtigung auf die 50 wichtigsten Regeln konzentrieren und diese auch überprüfen und bei Nichteinhaltung die Lizenz entziehen.
Die Finanzkrise habe eine bessere Basis für populistische Politik geschaffen, dass sei sehr gefährlich, warnte Treichl. Der Boden dafür werde umso größer, je größer die Arbeitslosigkeit werde, diese gelte es besonders zu bekämpfen. Treichl sieht auch wieder die Gefahr, von einem kapitalistischen wieder in ein Staatswirtschaftssystem hineinzurutschen. Dieser Schwenk könnte dadurch abgefedert werden, wenn von der Marktwirtschaft ein Beitrag an die Gesellschaft fließt, der helfe, die Anzahl der Arbeitslosen zu reduzieren, und Menschen beim Einstieg ins Wirtschaftsleben unterstützt.
Deshalb sollte das "soziale Unternehmertum" stärker gefördert werden, damit könnte der Graubereich zwischen Staat und Privat ausgefüllt werden. Unternehmen sollten von sich aus einen Teil ihres Gewinnes für soziales Unternehmertum verwenden und in den Sozialstaat investieren.